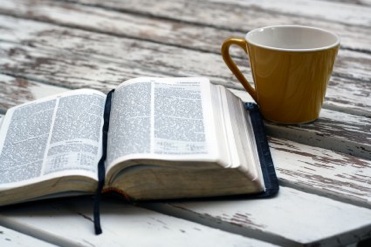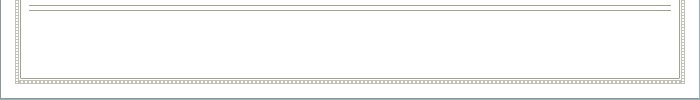Formkritik


Formkritik

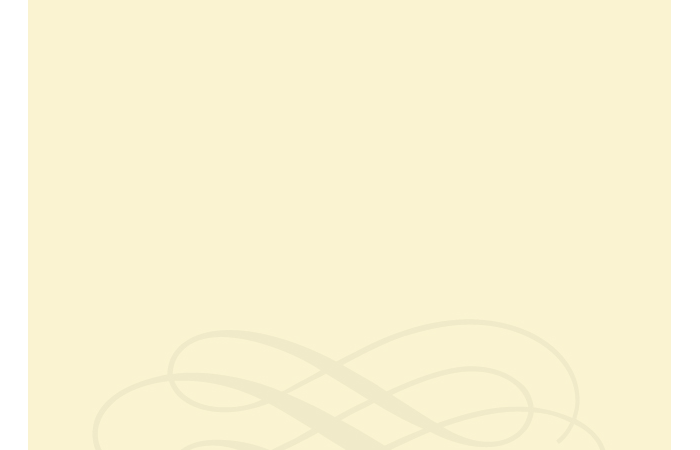
Formkritik
Die Formkritik ist zunächst ein weiterer Arbeitsschritt, der zur Textbeschreibung auf der Endtextebene dient. Nach den Regeln antiker Rhetorik gibt es grundsätzlich drei Intentionen, die ein Autor haben kann, wenn er einen Text verfasst: Er kann etwas einfach darstellen wollen (epideiktisch), er kann den Leser beraten wollen (symbuleutisch), was meist zu einem entsprechenden Handeln des Lesers führt bzw. führen soll, oder er kann etwas begründen (dikanisch). Da biblische Texte aber oftmals aus unterschiedlichen Textanteilen bestehen, was wiederum auf das Wachstum der Texte zurückzuführen ist, hatten die Autoren entsprechend divergierende Intentionen, was sich dann in unterschiedlichen Formen innerhalb eines Textes widerspiegelt.
Epideiktische Textsorten sind u.a. Personenbeschreibung, Liste, Hymnus, Gebet, Biographisches, Visionsbericht, apokalyptische Gattungen, Orakel, Liturgie, Zeichenhandlung, Reisebericht,
Selbstgespräch, Ätiologie, Märtyrerbericht, Summarium.
Symbuleutische Textsorten sind u.a. Aufforderung, Paränese, Mahnrede, Haustafel, Warnung, Tugend-/Lasterkatalog, Seligpreisung, Unheilsansage, Wehewort, Gemeindeordnung, Brief.
Dikanische Textsorten sind u.a.: Apologie, begründete Unheilsansage, begründete Heilsansage, Urteil, Beurteilung, Zeugenbericht
Mischungen von Formen, die je nach Kontext die Aussagerichtung wechseln können, finden sich u.a. in bildhaften Texten (Gleichnis, Metapher, Vergleich, Allegorie), Sentenzen, Reden, Testamenten, Chrien, Argumentationen, Midraschim und Schriftzitaten.
Aus diesen Überlegungen ergeben sich folgende Fragestellungen, die bei der Textarbeit zu beachten sind:
1. Ist der Text insgesamt einer literarischen Form zuzuordnen?
2. Wenn ja, welche literarische Form hat der Text; wenn nein, welche literarischen Formen sind in ihm vereint?
3.Welches ist die generelle Aussagerichtung des Textes (darstellend, beratend, beurteilend)?
Um dieses herauszufinden, bietet es sich an, den Text Satz für Satz auf die drei Aussagerichtungen hin zu untersuchen und anschließend eine generelle Tendenz herauszustellen. Diese ergibt sich natürlich nicht rein quantitativ. Vielmehr muss der Textverlauf mit gesetzten Höhepunkten in Betracht gezogen werden, um sagen zu können, welche Textform die Intention des Autors wiedergibt.
Als Hilfsmittel für diese Arbeit steht das Buch Formgeschichte des Neuen Testaments von Klaus Berger zur Verfügung, in dem alle neutestamentlichen Texte auf ihre Aussageintention hin betrachtet werden.
Neben die Beschreibung der Aussageintention mit der Formkritik tritt die Bestimmung der Gattung eines Textes. Diese fragt danach, wo in der antiken Welt ein derartiger Text Verwendung fand. Dieses nennt man den Sitz im Leben eines Textes. Die Bestimmung des Verwendungszweckes geht also davon aus, dass ein Text nicht als reine Literatur, sondern als Teil eines Verkündigungs- oder Vermittlungsprozesses verfasst wurde. Es geht also darum, zu bestimmen, in welchen Situationen ein derartiger Text grundsätzlich gebraucht werden konnte. Die genaue historische Gegebenheit lässt sich nur bei einer geringen Anzahl von Texten bestimmen.
Zum Beispieltext: Innerhalb von Mt 8,5-13 finden sich unterschiedliche Formen, die nun im einzelnen aufgenommen werden. V5 ist rein epideiktisch, er führt in die Erzählung ein. Der anschließende V6 ist ebenfalls epideiktisch, mit ihm wird der Leser mit der Problemstellung konfrontiert. V7 führt dies fort, Jesu Zusage, den Knaben zu heilen, ist epideiktisch (darstellend). Erst in V8 bringt der Autor eine neue Aussageabsicht in den Text ein. Dieser Vers ist symbuleutisch, was sich in der Handlungsanweisung V9 fortsetzt. In V10 verändert sich dies erneut, indem durch Jesus eine Wertung ausgesprochen wird. Sowohl dieser Vers als auch die folgenden beiden sind dikanisch. Mit V13a kehrt die Erzählung wieder zur symbuleutischen Aussageabsicht zurück. Jesus rät dem Hauptmann, wieder zu seinem Haus zurückzukehren. V13b ist schließlich epideiktisch, die Erzählung wird mit der Erfüllungsaussage abgeschlossen.
Welches Fazit lässt sich nun aus den Beobachtungen ziehen? Zunächst ist festzuhalten, dass die Erzählung in ihrer Endform dikanisch ist. Die Erwählung der Völker und die Verwerfung der Kinder des Reiches stehen im Zentrum von Mt 8,5-13. Die Rahmenerzählung über die Bitte des Hauptmanns ist symbuleutisch, auf den Gesamttext bezogen begründet sie, wie Jesus zu dieser Aussage kommt. Folgt man den Ergebnissen der Textkohärenzprüfung, dann treffen hier zwei Erzählungen mit unterschiedlichen Charakteren aufeinander. In Mt 8,5-9.13 findet sich eine symbuleutische Erzählung, die dem Leser ein Handlungsmodell vorgibt. Sie soll erklären, wie man richtig glaubt. Die Vv10-12 sind rein dikanisch. In ihnen wird begründet, warum die Völkerwelt am eschatologischen Mahl teilnehmen wird, und ebenso, warum die Israeliten ausgeschlossen werden. Das Kriterium, nach dem dieses Urteil gefällt wird, ist der gezeigte Glaube, der den Israeliten vom Evangelisten offensichtlich abgesprochen wird. Was sich in der Textkohärenzprüfung andeutete, findet hier seine Bestätigung: Der Text ist nicht einheitlich, sondern in ihm wurden unterschiedliche Stücke zu einem neuen Text zusammengefügt.
Abschließend ist die Frage zu stellen, in welchem Kontext (Sitz im Leben) diese Texte verwendet wurden. Für die Einzelerzählungen ist dies recht einfach zu erklären: Die Vv5-9.13 ist ein Lehrbeispiel für wahren Glauben. Die Menschen, die eine solche Geschichte hören, sollen verstehen lernen, wie man als Christ glauben kann. In dieser Form kann sie Gegenstand einer Predigt oder der Katechese gewesen sein.
Der Spruch Jesu in den Vv10-12 ist nur unwesentlich schwerer zu verorten. Mit ihm wird die Verbreitung des Christentums unter Nicht- Juden und zugleich die zunehmende Abkehr vom Judentum begründet. Der Text hat rechtlichen Charakter und kann als Teil der Diskussion innerhalb einer urchristlichen Gemeinde um den Umgang mit gläubigen Nicht- Juden und ungläubigen Juden verstanden werden. Der Leser wird hier Zeuge eines innergemeindlichen Diskussionsprozesses, in dem durch ein Jesuswort Klarheit über die eigene Ausrichtung gewonnen wird.
Durch das Zusammenstellen der beiden Erzählungen erhält die Geschichte einen neuen Tenor. In der matthäischen Gemeinde, in der dieser Text so verwendet wird, wird mit der Erzählung vom Hauptmann von Kapernaum begründet, warum man eine eschatologische Scheidung von gläubigen und nicht-gläubigen Gemeindegliedern erwartet. Deutlich wird, dass die Gemeinde sich aus unterschiedlichen Anteilen zusammensetzt. Es gibt sowohl gläubige wie nicht-gläubige ursprünglich jüdische Mitglieder als auch ursprünglich nicht-jüdische Christen, die die Messianität Jesu anerkennen. Mit dem Text warnt der Evangelist davor, vor der erwarteten Parusie eine Trennung von gläubigen und nicht-gläubigen Gemeindegliedern zu erwarten. Diese wird kommen - aber gemäß dem Spruch Jesu erst, wenn das eschatologische Mahl eingesetzt wird. In der vorliegenden Gestalt dient der Text also als Lehrstück für die Gemeinde, der in Predigt oder Katechese seine Anwendung fand.
Die Formkritik dient dazu, die Aussagerichtung (Intention) eines Textes zu erfassen.
Die Form eines Textes ist Bestandteil ihres Inhalts und nicht von diesem zu trennen. Denn es macht einen Unterschied, ob ein Text mit „es war einmal ...“ oder mit „liebe Gemeinde“ oder
gar mit einem Jingle beginnt. Der Leser / die Leserin wird so von vornherein im Verständnis des Inhalts gelenkt. Das heißt, die Aussagerichtung und der Informationsgehalt werden bereits durch die Form angezeigt.